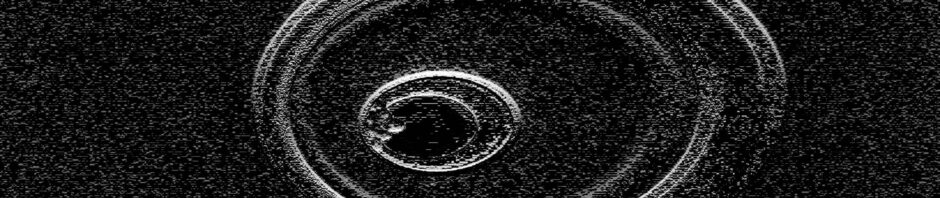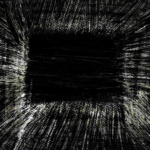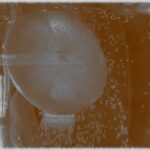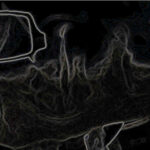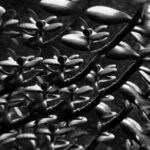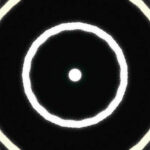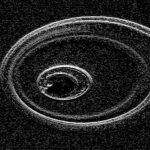Eines Morgens wache ich auf und stelle fest, mein Herz schlägt nicht mehr. Das erstaunt mich und ich versuche den Rhythmus zu finden. So liege ich nach innen forschend, fühlend im Bett. Bewegungslos. Ich spüre nichts. Wartend. Scheinbar leere Momente zählend.
Unschlüssig zögerlich bewege ich mich und nehme wahr, dass die Schwerkraft nicht intakt ist. Ich schwebe, bin flüchtig. Wundernd richte ich mich unbeholfen auf. Eigenartig befremdliche Bewegungen. Es ist, als würde ich durch mich hindurch fühlen und fallen, als wäre ich ein Teil der Luft. Ob ich mich wohl selber atmen könnte? Würde ein Fenster geöffnet, der Luftzug zöge mich hinaus, nach draußen, nach außerhalb des Raumes, des Hauses. Mich weiterhin wundernd, denke ich im Augenblicke dieses flüchtigen Daseins, an ein Interview, welches ich vor zehn Jahren mit einem Heroinhändler führte. Das Interview fand in einem Gefängnis statt und der zu Interviewende war gerade 21 Jahre alt.
Als ich geistig noch bei der ersten Frage des Interviews verharre, kommt meine Frau in den Raum und öffnet ein Fenster und sagt, ich solle endlich aufstehen, Kaffee sei fertig und sie müsse nun los, arbeiten und-und-und. Mehr höre ich nicht, denn es zieht mich hinaus und ich verbinde mich mit der Atmosphäre, werde zu einem Tiefdruckgebiet und regne drei Jahre lang.
Als alle Menschen in diesem Land, Schwielen und Falten von der permanenten Feuchtigkeit haben, höre ich auf und entwickele mich zurück zum Menschen und mein Herz schlägt und ich spüre wieder die Schwerkraft. Ich ruhe mich aus. Schlafe. Sieben Tage und Nächte.
Am nächsten Morgen wache ich auf, trinke schwarzen Kaffee und besuche die Nassräume. Nach der Dusche ziehe ich einen überwältigenden, dunkelblauen Anzug an, gebe meiner wieder glatthäutigen Frau einen Kuss und verlasse das Haus.
Für den Weg zur Arbeit nutze ich die öffentlichen Verkehrsmittel. Ich lächele. Morgens ist das Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel nicht sehr lustig. Manchmal hilft ein Lächeln. Letztlich ist es jedoch fast nie lustig, in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es sind so viele Besonderheiten unterwegs. Zumeist bin ich der Einzige, der mir ausreichend normal erscheint. Bisweilen hat man noch ein oder zwei Menschen, welche die Uhr richtig ticken hören. Für die Masse jedoch, tickt die Uhr anders.
Diese Szenerie morgens erinnert mich an moderne japanische Filme. Ich kann mir einen Sitzplatz sichern, da ich an einer Haltestelle einsteige, an der nicht viele Menschen einsteigen, Stadtrand. So sitze ich da und versuche teilnahmslos aus dem Fenster zu schauen, während sich die Straßenbahn mit Menschen füllt, welche ich auffällig unauffällig beobachte. Ich denke gelegentlich, dass kann doch niemand wollen, was sich hier jeden Morgen ereignet. Und doch, es findet statt. Dicht gedrängt. Rücken an Rücken. Seite an Seite. Geräusche. Feuchtigkeit. Eine zu starke, unangenehme Wärme oder zu starke, schüttelnde Kälte. Von Gerüchen will ich gar nicht erst anfangen. Das kennt jeder, der in einem überfüllten Bus oder in einer überfüllten Straßenbahn saß oder stand. Schön ist das nicht, auch nicht nach drei Jahren Regen. Aber doch, es ist irgendwie interessant.
Die meisten Menschen sitzen oder stehen ihre Häupter gesenkt da und blicken auf Displays. Lautsprecher in den Ohren, mit den Fingern wischend, immer in Bewegung. Altersgruppe: ca. 15-68 Jahre. Einige telefonieren und versuchen leise dabei zu sein. Andere telefonieren und versuchen laut dabei zu sein. Ebenso wird es mit Gesprächen und Selbstgesprächen gehandhabt.
Ich spüre einen Blick auf mir ruhen. Ach ja, da ist ein Mann, der mich anblickt. Ich sah ihn mal am Hauptbahnhof, dort ist sein Herrschaftsgebiet. Die Anderen versuchen von ihm Abstand zu halten, denn er scheint sich lange nicht gewaschen zu haben. Als ich ihn einst am Hauptbahnhof sah, bediente er sich an einem Mülleimer. Es schien mir damals so, als würde er einen halben Cheeseburger eines großen und zu unrecht beliebtem Fast-Food-Restaurants aus dem Behältnis fischen, welchen er kurzerhand in seinen Mund schob und mit zwei Bissen in sich hinein saugte.
Eine surreale Szene. Um uns herum liefen und tobten die Menschen, hatten es eilig oder wollten einfach nur weg. Vielleicht weg von sich selbst? Viele rannten, ob ihres dürftigen Zeitmanagements, um noch einen Zug zu erreichen und versuchten sich dabei aus dem Weg zu gehen, was eigentlich unmöglich war, da so viele Personen dort liefen, gingen, standen, schliefen.
Bettelnde Erdenbewohner auf dem Asphalt vor den großen und doch zu kleinen Eingangstüren. Läufige Banker. Geschäftige Obsthändler. Verdächtiges Sicherheitspersonal. Sanfte Handwerker. Rauchende Rollstuhlfahrer. Aggressive Rentner. Torkelnde. In diesem Setting stand der Mann und aß sein gefundenes Mahl.
Ich sitze also in der Straßenbahn und der Mann sieht mich an. Er wirkt, gleichsam wie damals am Hauptbahnhof, ruhig und wissend, irgendwie abgeklärt, ja, amüsiert, angekommen. Seine Haare lang und filzig, Rastas. Die Haare scheinen ein Eigenleben zu führen. Seine Kleidung ist dieselbe, wie an dem Tag am Bahnhof. Unter seiner schmutzigen Jacke blicken Plastiktüten unter den Ärmeln hervor. Genauso unter den Enden der Hose an der Taille und seiner Hosenbeine und an seinem Hals. Wie am Bahnhof. Ich hatte den Eindruck, er schütze sich damit. Vielleicht vor dem Virus der verkohlenden Zeitknappheit. Dem Virus, dem die Menschen sich immer mehr aussetzen und immer weniger anzukommen scheinen. Wie er mich jetzt so ansieht, glaube ich nicht, dass er sich schützen müsste. Er sieht mich an, sieht durch mich hindurch, nein, ich glaube, er entdeckt etwas in mir, er entdeckt, dass ich nicht frei bin. Vielleicht, nein, ganz sicher, sieht er die langatmige Order der menschlichen Existenzsicherung in mir.
Ich habe den Eindruck, er ist völlig in diesem Augenblick. Dieser Mann fragt nicht mehr, er weiß schon alles. Er ist einer Wahrheit habhaft, welche die meisten in diesem Leben nicht kennen lernen werden. Er hat dieses ganze Theater hinter sich. Dieser Mann spielt nur noch und das mit allen Sinnen. Er nimmt sich nicht mehr unnötig wichtig, körperliche Grundbedürfnisse ja, ansonsten nur lächeln, er weiß, er ist für ein höheres als das menschliche Ideal von Bedeutung.
In diesem Augenblick erscheint er mir wie ein Wächter. Er wacht über die Menschen, über die getriebenen Existenzen. Wachend, mit vollem Bewusstsein bei sich selbst. Dieser Mann muss nichts beweisen, bewegen, erschaffen, muss sich nicht einer Machtstruktur schenken, um sich besser zu fühlen. Er muss auch nicht wählen oder sich für etwas Neues entscheiden, geschweige denn, konkurrieren. Eine reine Form der Existenz. Aufs Wesentliche reduziert oder besser: Auf das Wesentliche erhöht. Ich habe das Gefühl, er blickt in mich hinein und rät, nein, weiß, was ich denke und ich lächele ihn an. Ihn, der immer zu lächeln scheint und nur Hunger und Durst kennt aber kein Begehren, kein sich Profilieren, kein um Liebe-Kämpfen, kein Besitzen-Wollen.
Weiser Wächter, bitte gib mir etwas von deinem Wissen. Lass mich teilhaben an deiner Weisheit. Will ich doch ebenso zur Ruhe kommen und in Liebe mit mir selbst und in Liebe mit den noch suchenden Menschen sein, mehr nicht – mehr nicht!
Er wacht über uns. Er wacht über mich. Und jetzt, als ich diese Gedanken denke, erinnere ich mich daran, dass vor meiner Zeit als Tiefdruckgebiet, dieser wachende Mann mir täglich begegnet ist. Jeden Tag saß oder stand er in meiner Nähe und wachte. Vielleicht will er mich abholen, irgendwohin, wo es lebendiger ist, als in dieser Straßenbahn. Lebendiger als wir Eilenden, wir uns um uns selbst Drehenden. Wir gottvergessene Derwische.
Die Haltestelle an der ich aussteige, der Hauptbahnhof, ist die nächste. Ich nicke dem Wächter beim Aufstehen zu und ströme im Fluss der Aussteigenden aus der Straßenbahn. Das Wetter ist typisch für die Gegend. Es ist bewölkt, doch trocken. Ich suche Schutz an einer Werbetafel und blicke den Mann durchs Fenster der Straßenbahn an und sehe, wie er langsam aufsteht und aussteigt. Er geht zum nächsten Mülleimer. Er greift hinein und zieht einen halben Hamburger heraus und beißt zu. Beißt nochmals zu und der halbe Hamburger ist weg. Danach nimmt er sich einen Zigarettenstummel vom Asphalt und zündet diesen an. Er zieht mehrmals daran und löst sich auf.
Ich bin allein mit all den anderen Menschen. All den wichtigen und beschäftigten Menschen. Einige atmende Augenblicke später strenge ich mich an, rennend, den für mich so wichtigen ICE zu bekommen, den um kurz nach, den, der mich am Ziel angekommen, in die Arbeitswelt entlässt.